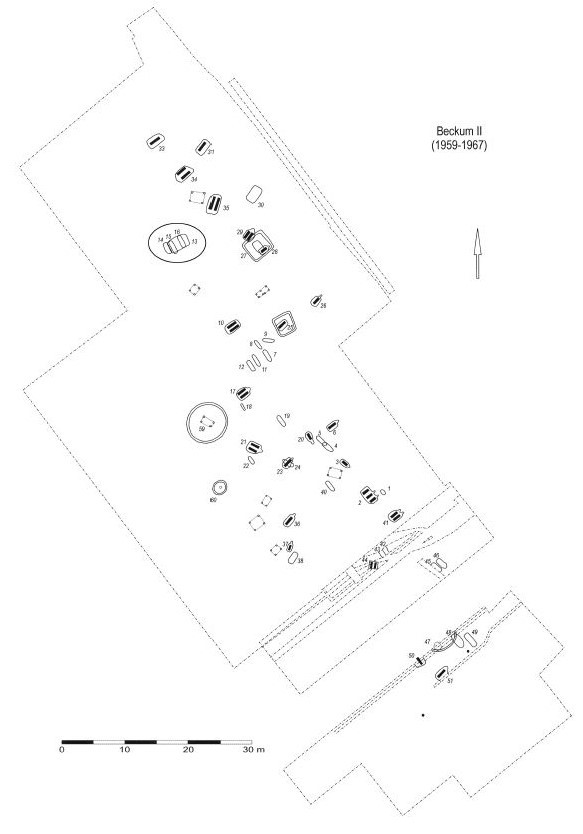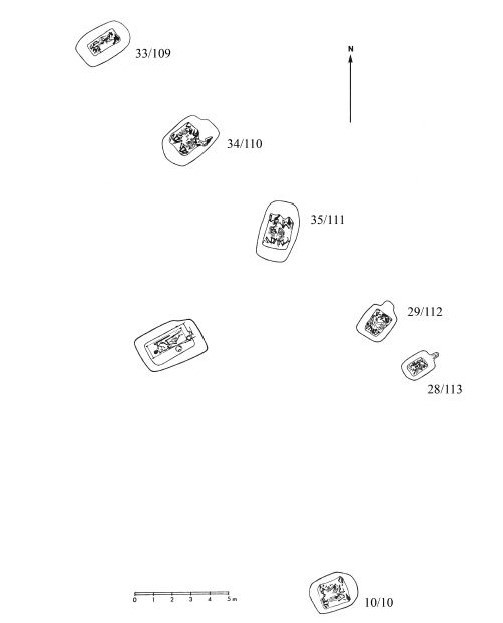Literaturverzeichnis
Archäologie in Rheinhessen und Umgebung e. V (Hrsg.), Berichte zur Archäologie in Rheinhessen und Umgebung Jahrgang 7 (2014)
B. Ludowici – H. Pöppelmann (Hrsg.), Das Miteinander, Nebeneinander und Gegeneinander von Kulturen Zur Archäologie und Geschichte wechselseitiger Beziehungen im 1. Jahrtausend n. ehr. (2011)
LWL-Altertumskomission, Vera Brieske, unpubliziert, Beckum II
LWL-Altertumskomission, Vera Brieske, unpubliziert, Grabinventare aus Beckum, die sich in der Schausammlung in Herne befinden
W. Winkelmann, Das sächsische Fürstengrab (1974) - Sonderdruck aus „Stadt Beckum“
Abbildungsverzeichnis:
Abbildung1 des Nekropolenplanes: Nach Brieske 2011, 128 Abb. 5.
Abbildung2 des Fürstengrabplanes: Ahrens 1978, 669.
Abbildung3 des Grabes im Museum, Bildrechte: LWL-Museum für Archäologie Herne/ S. Brentführer
Abbildung4 der Grabbeigaben im Museum, Bildrechte: LWL-Museum für Archäologie Herne/ C. Moors
Abbildung5 der Byzantinischen Garnitur, Bildrechte: LWL-Museum für Archäologie Herne/ C. Moors