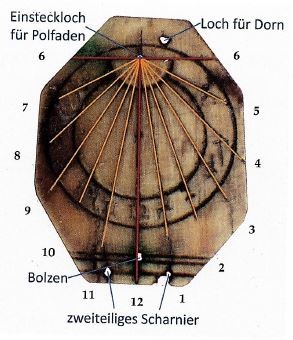Birmann, Dieter. „Zeitanzeige und Ortsanalyse - Was Klapsonnenuhren aus Münster und Dülmen verraten“. Archäologie in Westfalen-Lippe 2020, herausgegeben von Birgit Münz-Vierboom und Michael M. Rind, Bd. 12, Beier und Beran, 2021.
Kaschuba, Wolfgang. Die Überwindung der Distanz: Zeit und Raum in der europäischen Moderne. Fischer Taschenbuch Verlag, 2004.
LWL-Archäologie für Westfalen, Herausgeber. 100 jahre/100 funde: Das Jubiläum der amtlichen Denkmalpflege in Westfalen-Lippe. Dr. Rudolf Habelt, 2020.
Nolde, Nadine und Hans-Werner Peine. „Von Lehrlings- und Meisterstücken - Messerherstellung im frühneuzeitlichen Dülmen“. Archäologie in Westfalen-Lippe 2017, herausgegeben von Michael M. Rind und Aurelia Dickers, Bd. 9, Beier und Beran, 2018, S. 213–17.
Schewe, Roland. „Eine Nürnberger Klappsonnenuhr von Thonias Tucher: Die besonderen Materialwertigkeiten exotischer Werkstoffe“. Jahresschrift Deutsche Gesellschaft für Chronometrie, Bd. 43, 2004, S. 153–67.
Schewe, Roland. „Fundorte von Taschensonnenuhren in Mittel- und Osteuropa: Länder und Städte - Beschreibung und Bibliografie“. Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte, von Schweizerisches Nationalmuseum, Bd. 76, Nr. 1+2, 2019, S. 31–57.
Schewe, Roland und Jürg Goll. „Die Zeit in der Tasche - die älteste in Europa erhaltene hölzerne Klappsonnenuhr aus dem Kloster Müstair, Schweiz“. Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte, Bd. 76, Nr. 1+2, 2019, S. 5–30.