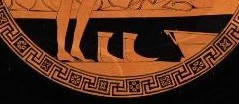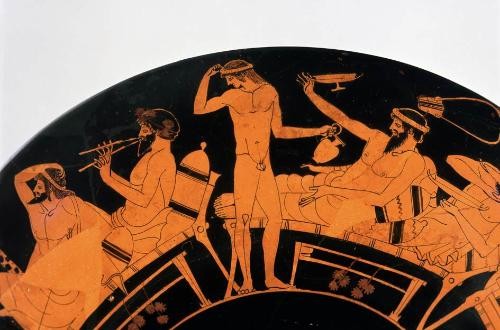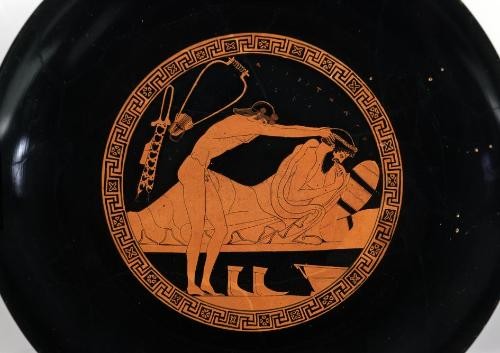A. Dalby, Essen und Trinken im alten Griechenland. Von Homer bis zur byzantinischen Zeit (Stuttgart 1998).
G. Hagenow, Aus dem Weingarten der Antike. Der Wein in Dichtung, Brauchtum und Alltag, Kulturgeschichte der Antiken Welt 12 (Mainz 1982).
F. Hobden, The Symposion in Ancient Greek Society and Thought (Cambridge 2013).
M. Maaß, Griechische Vasenbilder. Maler und Dichter. Mythos, Fest und Alltag, Bildhefte des Badischen Landesmuseums Karlsruhe NF 4 (Karlsruhe 2007).
O. Murray (Hrsg.), Sympotica. A Symposium on the Symposion (Oxford 1994).
O. Murray – M. Tecuşan (Hrsg.), In Vino Veritas (Rom 1995).
E. Stein-Hölkeskamp, Adelskultur und Polisgesellschaft. Studien zum Griechischen Adel in Archaischer und Klassischer Zeit (Wiesbaden 1989).
M. Weçowski, The Rise of the Greek Aristocratic Banquet (Oxford 2014).
J. Wilkins – R. Nadeau (Hrsg.), A Companion to Food in the Ancient World (Chichester 2015).